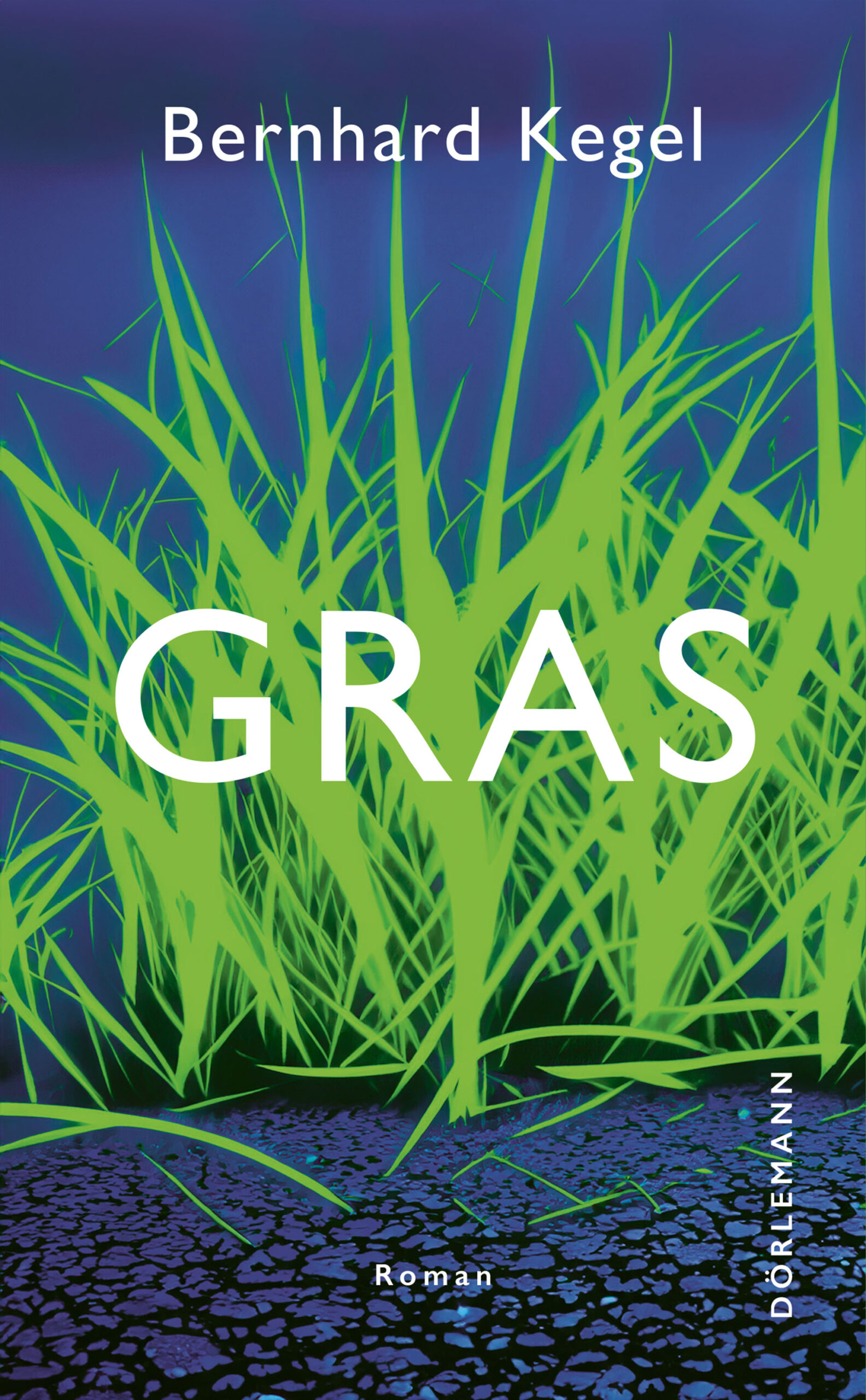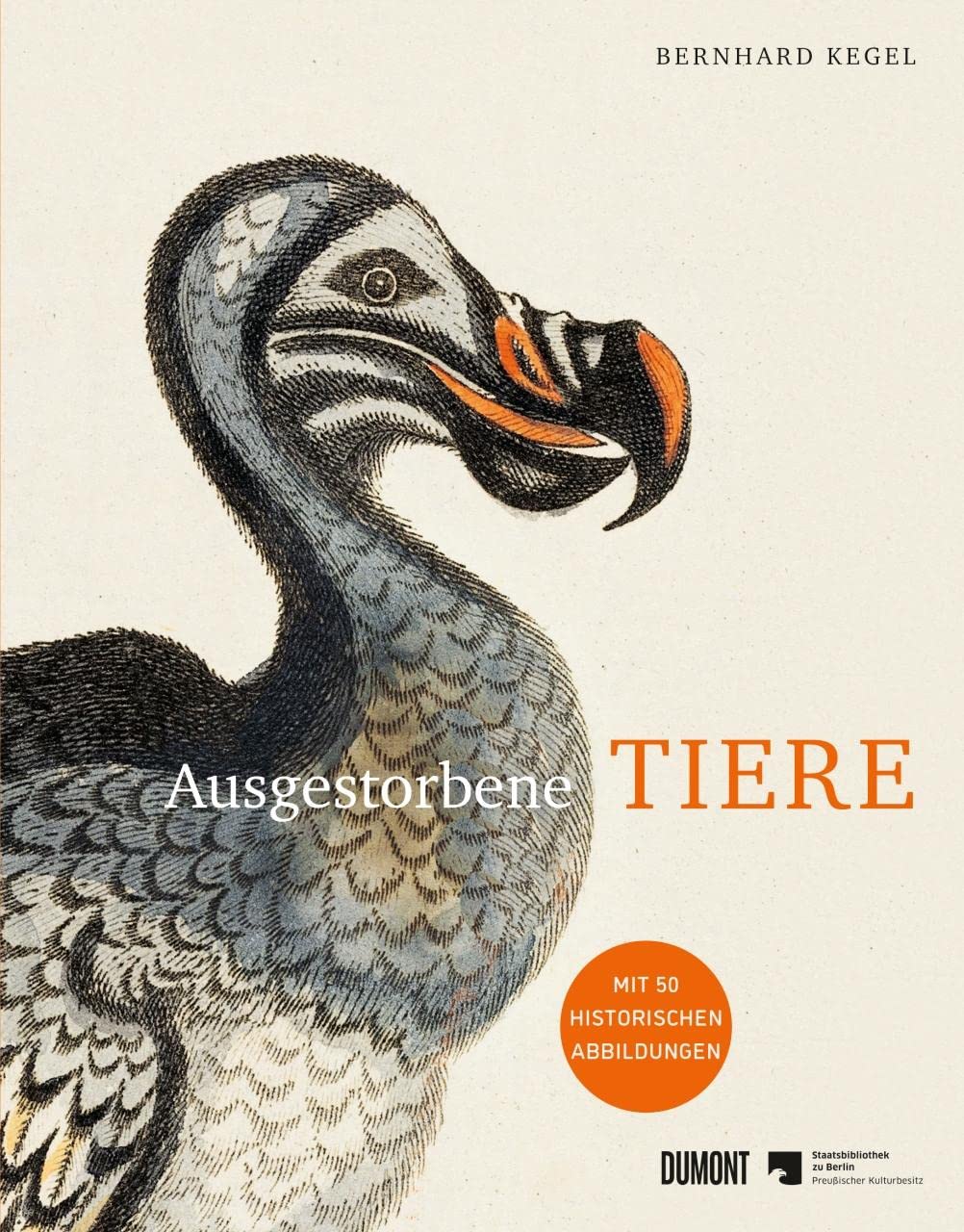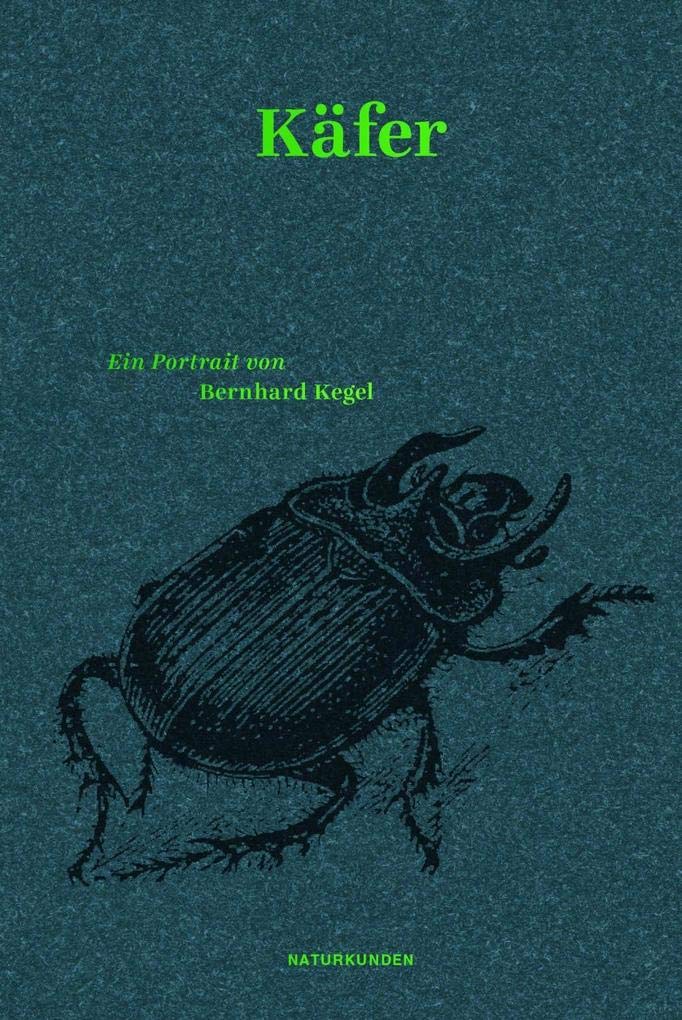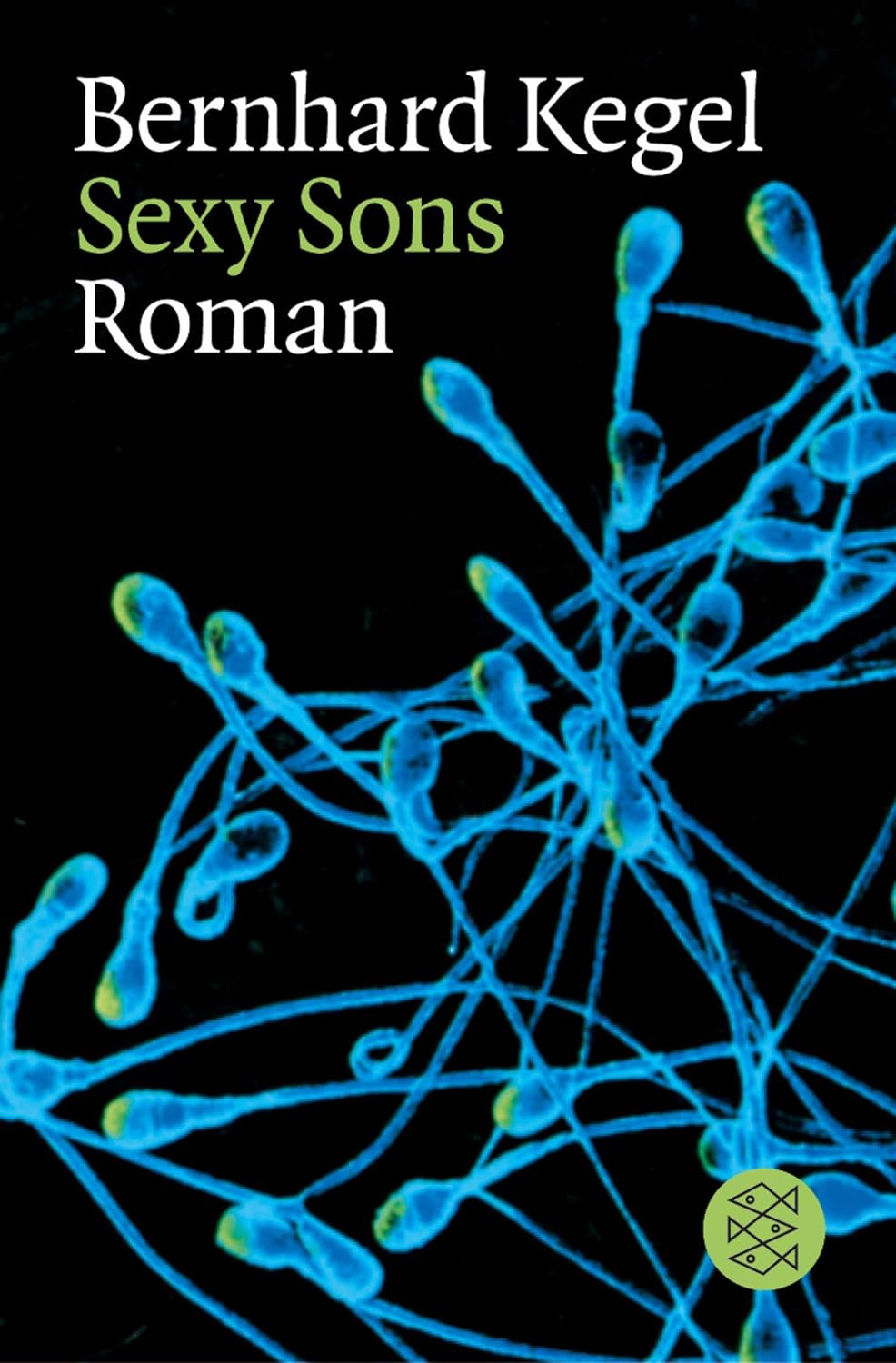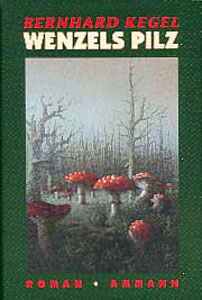Einleitung
Endlich wieder Schnee, viel Schnee. Ein Winter wie früher, wie er sein sollte. Auf dem Gletschereis im Schweizer Skigebiet Glacier 3 000 der Waadtländer Alpen liegt im Frühjahr 2018 eine dicke Schicht der weißen Pracht, dicht und kompakt, das Ergebnis eines Winters mit weit überdurchschnittlichen Schneefällen. Für den schrumpfenden Gletscher kommt das einer Frischzellenkur gleich. 50 Prozent mehr Schnee als in normalen Jahren – das ist Wasser für einen Verdurstenden. Vielleicht kommt es doch nicht so schlimm wie befürchtet. Ein paar Winter wie dieser und man könnte fast wieder Hoffnung schöpfen.
Die allgemeine Euphorie steckt sogar Matthias Huss und seine Mitarbeiter an. Der Experte von der ETH Zürich ist Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes. Regelmäßig besucht er die jahrtausendealten alpinen Eismassen, führt Messungen durch, und eigentlich kommt ihm für das, was er dort seit Jahren tut und erlebt, nur noch ein Wort in den Sinn: »Sterbebegleitung«. Da ist ein Winter wie dieser natürlich eine erfreuliche Abwechslung, sogar für Glaziologen.
So wird ein Fernsehteam des SWR, das Huss und seine Kollegen begleitet, am 25. April 2018 Zeuge einer Messung, wie es schon lange keine mehr gegeben hat. Mehr als fünf Meter tief muss die Sonde durch die Schneedecke getrieben werden, bis sie auf hartes Eis trifft. Es könnte ein gutes Jahr für die Alpengletscher werden, zumindest für diesen, denn nicht überall ist so viel Schnee gefallen.
Fünf Monate später statten Matthias Huss und seine Mitarbeiter dem Gletscher im Glacier‑3 000-Gebiet einen zweiten Besuch ab. Mitte September gilt es nun Bilanz zu ziehen, die Sommerbilanz des Jahres 2018. Schon auf dem Weg zur Messstelle wird deutlich, dass sie nicht gut ausfallen wird, trotz der imposanten Schneedecke, die das Eis eigentlich hätte schützen müssen. Die Euphorie war verfrüht. Von den Schneemassen des letzten Winters ist nichts übrig geblieben.
Was die Gletscherforscher zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: In der Schweiz, in Österreich und in Deutschland wird 2018 als das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 130 Jahren in die Statistik eingehen, global gesehen wird es Rang vier einnehmen, nach 2016, 2015 und 2017. 2019 und 2020 werden weltweit noch wärmer und schieben sich zwischen 2016 und 2015.
»Wenn man sich das vorstellt«, sagt Huss in die Fernsehkamera. »Fünf Meter Schnee auf dreitausend Meter Höhe … Dass das in einem Sommer wegschmelzen kann, hätten wir nicht für möglich gehalten.«
Nicht nur der Schnee ist verschwunden, auch der Gletscher ist weiter geschrumpft. Die Eisschicht ist um 1,30 Meter dünner geworden. Die enormen Schneemassen des Winters 2017/18 haben nicht einmal für eine Atempause gesorgt. Das sogenannte Peak Water, der Wendepunkt, von dem ab die durch das Schmelzen des Eises abfließende Wassermenge wegen des Volumenverlusts der Gletscher nur noch abnimmt, sei hier wohl erreicht, vermutet Matthias Huss.
Der Schwund der Alpengletscher geht weiter. Allein in den Jahren 2000 bis 2014 ist ein Sechstel des Eisvolumens in den Alpen abgetaut. Gegen Ende des 21. Jahrhunderts wird es wohl nur noch in einigen Hochlagen Gletscher geben.
Die lokalen Folgen für Mensch und Natur werden dramatisch sein. Im globalen Vergleich sind die alpinen Gletscher allerdings Zwerge: Viel größere Eismassen gibt es in Alaska, in Patagonien und an den Polen. Zusammen mit Kollegen aus Frankreich, Norwegen, Kanada und Russland hat Matthias Huss kürzlich eine umfassende, auf Satellitendaten basierende Analyse von 19 000 Gletschern auf der ganzen Welt vorgelegt. Danach hat sich deren Eisverlust in den letzten 30 Jahren beschleunigt und liegt nun bei 335 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das entspricht etwa dem Dreifachen des gegenwärtig noch vorhandenen Gletschervolumens in den Alpen. Allein dadurch ist der Meeresspiegel seit 1960 um 27 Millimeter angestiegen.
Dies ist kein Buch über die Frage, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Diese Frage ist längst beantwortet, und man brauchte dazu weder leistungsfähige Großrechner noch Klimamodelle. Ein Blick auf die schwindenden Eismassen in den Gebirgen und an den Polen genügt; die seit Jahrzehnten steigenden Temperaturen sind eine unabweisbare Tatsache. Streit entzündet sich an der Frage, ob und wie sehr wir Menschen an dieser Entwicklung mitgewirkt haben und wie sich dieses verändernde Klima in den verschiedenen Weltgegenden auswirken wird.
Ich bin kein Klimaforscher und daher, was die Zuverlässigkeit dieser Zukunftsprognosen angeht, genauso auf die Arbeit der Experten angewiesen wie Sie, liebe LeserInnen. Ich habe allerdings keine Zweifel, dass die überwältigende Mehrzahl der Wissenschaftler engagiert und mit größter Gewissenhaftigkeit ihre Arbeit verrichtet. Die Frage nach den Ursachen des Klimawandels werden in diesem Buch nicht deshalb ausgeklammert, weil ich sie für ungeklärt halte. Das Gegenteil ist der Fall. Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), der sogenannte »Weltklimarat«, der die weltweit von Tausenden von Wissenschaftlern durchgeführte Klimaforschung zusammenträgt, bündelt und in Form von umfangreichen Berichten veröffentlicht, erklärte in seinem fünften Sachstandsbericht, der Einfluss des Menschen sei »äußerst wahrscheinlich« (d. h. mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 Prozent) die Hauptursache für die seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachtende Erwärmung. Viel mehr kann eine Wissenschaft, die sich mit einem so komplexen Phänomen wie dem globalen Klima beschäftigt, kaum erreichen. Ich habe deshalb keine Veranlassung, an den, je nach Szenario, mehr oder weniger dramatischen Modellprojektionen zu zweifeln, die die Klimaforscher erarbeiten, auch wenn sie eine alles andere als erfreuliche Zukunft in Aussicht stellen. Außerdem entspricht die Entwicklung bislang ziemlich genau den Vorhersagen. Fast alle Prognosen, sogar die, die bereits vor 50 Jahren abgegeben wurden, haben die Entwicklung bis zum Jahr 2020 zutreffend beschrieben. Und die heutigen Modelle sind noch besser geworden, weil die Forscher aus früheren Fehlern und Fehleinschätzungen gelernt haben.
Auch wenn man, aus welchen Gründen auch immer, nicht an einen weitgehend menschengemachten Klimawandel glaubt – wir wissen, dass die meisten globalen Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte mit steigenden beziehungsweise hohen CO2-Konzentrationen der Atmosphäre einhergegangen sind. Es wäre demnach, unabhängig von der Frage nach der Ursache, in keinem Fall eine gute Idee, diese für die Menschheit bedrohliche Entwicklung noch zu befeuern, indem wir weiterhin zusätzlich tonnenweise Treibhausgase in die Atmosphäre ausstoßen, Gase, die dort für Tausende von Jahren verbleiben werden. Wir tun es bislang in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit, denn die Hälfte des insgesamt durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangten Kohlendioxids, etwa 890 Milliarden Tonnen, wurde in den letzten 30 Jahren ausgestoßen, von einer einzigen Menschengeneration, von uns. Schon deshalb gilt es, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um den Schaden und die für große Teile der Menschheit existenzbedrohenden Probleme, die auf uns zukommen, zu begrenzen, und uns, so gut es geht, auf die neuen Gegebenheiten vorzubereiten – eine Herkulesaufgabe, deren Erfolg keineswegs garantiert ist.
Steigt die Lufttemperatur von 28 auf 29 Grad oder von 5 auf 6 Grad Celsius, bemerken wir in unserer Umwelt in der Regel keine oder nur minimale Veränderungen. Steigt sie aber von ‑1 auf 0 Grad Celsius oder gar darüber, sind die Konsequenzen unmittelbar und dramatisch. Deshalb ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel so oft von Gletschern, polaren Lebensräumen und Permafrostböden die Rede. Weil Wasser in seinem festen Aggregatzustand eben bei null Grad Celsius zu schmelzen beginnt und wir diesen für die meisten Menschen immer noch sehr abstrakten Klimawandel dort, wo es Eis gibt, tatsächlich sehen können. Wer, in welcher Form auch immer, auf dieses Eis angewiesen ist, wird große Schwierigkeiten bekommen.
Doch auch wenn es nicht sofort ins Auge sticht: Ein sich veränderndes Klima hat überall auf der Erde Konsequenzen. Es bedeutet nicht nur höhere Temperaturen, schmelzende Gletscher, mehr extreme Wetterereignisse und einen steigenden Meeresspiegel. Es bedeutet auch und vor allem, dass die natürlichen Lebensgemeinschaften in der Verteilung und Zusammensetzung, wie wir sie kennen, keinen Bestand haben werden. Natur wird bleiben, aber es wird eine andere Natur sein. Sollten wir eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um vier oder fünf Grad erleben, wären große Teile der Welt aus heutiger Sicht kaum wiederzuerkennen. Fünf Grad – das klingt nach wenig, entspricht aber dem Temperaturunterschied zwischen der letzten Kaltzeit, in der Kanada, das nördliche Europa und ein großer Teil Großbritanniens mit kilometerdicken Eisschichten überzogen waren, und der heutigen Warmzeit.
Für viele Menschen ist der Klimawandel etwas, das noch in der Zukunft liegt, dabei steht außer Frage, dass wir bereits mittendrin stecken, und gerade die Biologie liefert dafür überzeugende Beweise. »Der Klimawandel kommt sehr schnell, innerhalb einer Baumgeneration«, stellt Manfred Forstreuter fest, Pflanzenökologe an der FU Berlin, der sich schon 1984 in seiner Diplomarbeit mit dem Klimawandel beschäftigte. Damals musste er dafür in die USA gehen, weil es in Deutschland niemanden gab, der an diesem Thema arbeitete.
Trotz aller Konferenzen und Verträge hat der globale Ausstoß von CO2 auch in 2018 und 2019 weiter zugenommen. Erst 2020 sorgte die Corona-Pandemie für einen deutlichen Rückgang. Die Entwicklung schreitet also unaufhaltsam voran, womöglich – dafür gibt es beunruhigende Hinweise – schneller, als wir das angenommen haben. »Das Problem ist die Geschwindigkeit«, sagt auch Manfred Forstreuter. »In einer Generation passiert das, was sonst in 10 000 Jahren geschehen ist.«
Einige Wissenschaftler haben bereits vor tipping points gewarnt, vor »Kipp-Punkten«, die, wenn sie einmal erreicht und überschritten sind, keine Umkehr mehr ermöglichen.
Nur zwei extrem trockene und warme Jahre, 2018 und 2019, haben gereicht, um den deutschen Wald, der zu großen Teilen im 19. Jahrhundert gepflanzt wurde, schwer zu schädigen. Die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände nannte es eine »Jahrhundertkatastrophe«, sogar Bundeskanzlerin Merkel machte sich Sorgen und sprach von »sehr, sehr großen Waldschäden«.
Für Peter Berthold, den langjährigen Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen, steht fest: »Die Klimaerwärmung wird nicht nur gewisse marginale Verschiebungen in Ökosystemen bewirken. Vielmehr wird sie wohl alle Systeme, die sich bei uns seit der letzten Eiszeit vor 10 000 Jahren entwickelt haben, kontinentweit umwandeln – allerdings unter hohem ‚Reibungsverlust‘ an Artenvielfalt.« Und zu diesen Systemen gehört eben auch der mitteleuropäische Wald.
Um diese Umwandlung soll es im Folgenden gehen, um eine Tier- und Pflanzenwelt, der die Veränderungen ihrer Lebensumstände bereits anzusehen sind und die längst begonnen hat, darauf zu reagieren. Global oder Climate Change Biology heißt die neue Wissenschaft, die diese Prozesse untersucht. Wenn dabei die aktuellen Vorgänge in einem Atemzug mit vergangenen aus vormenschlicher Zeit behandelt werden, ist das keinesfalls als Relativierung im Sinne derjenigen zu verstehen, die einen menschengemachten Klimawandel leugnen und sich auf den Standpunkt zurückziehen, Klimaveränderungen habe es schon immer gegeben.
In der Biologie des Klimawandels steht nicht die Frage nach den Ursachen im Vordergrund, sondern die nach den Folgen für die Lebewesen und Ökosysteme unseres Planeten. Diese müssen und werden reagieren, so wie sie immer reagiert haben. Und sie tun es bereits jetzt, ob der Wandel nun von uns Menschen verursacht wurde oder nicht. Biologen studieren diese Phänomene seit mindestens 20 Jahren. Auch wer nicht an eine durch den Ausstoß von Treibhausgasen verursachte Erwärmung glaubt, muss sich wohl oder übel mit der Frage auseinandersetzen, wie mit diesen Veränderungen in aller Welt umzugehen ist, denn dass sie geschehen, steht unbezweifelbar fest.
Das Buch bildet damit eine Art Gegenstück oder Ergänzung zu David Wallace-Wells’ alarmierendem Klimareport The Uninhabitable Earth von 2019, der unter dem Titel Die unbewohnbare Erde auch auf Deutsch erschienen ist. Wallace-Wells schildert darin die katastrophalen Folgen des Klimawandels für die Menschheit, klammert ökologische und biologische Konsequenzen aber fast völlig aus. Ich fürchte, er hat recht, wenn er gleich zu Beginn seines Buches schreibt: »Es ist schlimmer, viel schlimmer, als Sie denken. Das langsame Voranschreiten des Klimawandels ist ein Märchen, das vielleicht ebenso viel Schaden anrichtet wie die Behauptung, es gäbe ihn gar nicht.« Doch im Gegensatz zu David Wallace-Wells, der – vermutlich weil er glaubt, seine Ausführungen würden dadurch überzeugender klingen – Wert auf die Feststellung legt, er sei kein Umweltschützer und noch nie campen gewesen, bin ich Biologe und definitiv ein Naturliebhaber, der das Zelten unter freiem Himmel schätzt, auch wenn ich wie er fast mein gesamtes Leben in Städten verbracht habe. Deshalb interessiert mich nicht nur die Frage, was der Klimawandel für uns Menschen bedeutet, sondern auch die, wie es den anderen Lebewesen ergehen wird, die diesen Planeten mit uns zusammen bewohnen. Beides ist ohnehin kaum voneinander zu trennen. Ich möchte versuchen zu verstehen, was da draußen, in Wald und Flur, in Gebirgen und Ozeanen, vor sich geht.
Was verraten uns die Erkenntnisse der Climate Change Biology über die Natur der Zukunft? In welche Richtung werden sich die Lebensgemeinschaften unseres Planeten entwickeln? Was geschieht schon jetzt? Die jungen Menschen, die überall auf der Welt lautstark protestieren, werden in dieser Umwelt leben. Wie wird die Natur beschaffen sein, die wir unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen?
Der US-Amerikaner John W. Williams, ein weltweit führender Experte für die Vegetation vergangener Jahrtausende, hat die Möglichkeiten, die Lebewesen in einem sich verändernden Klima bleiben, mit fünf knappen Worten umrissen: »move, adapt, persist, or die« – »bewege dich, passe dich an, halte durch oder stirb«. Die Climate Change Biology liefert Beispiele für alle diese Optionen.
Wenn wir uns im Detail dafür interessieren, wie Tiere und Pflanzen auf eine sich aufheizende Welt reagieren, ist ein ausführlicher Blick in die Vergangenheit unseres Planeten unabdingbar. Denn eines ist klar: Stillstand hat es auf ihm nie gegeben. Natur ist ein permanenter Prozess, der mitunter aus unterschiedlichen Gründen rasant Fahrt aufnimmt. Deshalb sind Gegenwart und Zukunft nur zu verstehen, wenn man weiß und berücksichtigt, was gewesen ist. Der Begriff »Naturgeschichte«, der im Zeitalter der Laborbiologie hoffnungslos altmodisch klingt, hat dieser Tatsache Rechnung getragen. In seiner Kurzen Naturgeschichte des letzten Jahrtausends von 2007 hat Josef H. Reichholf eindrucksvoll gezeigt, wie groß die Turbulenzen allein während der vergangenen 1 000 Jahre waren – eine erdgeschichtlich kurze Zeitspanne, und doch fanden darin das Mittelalterliche Klimaoptimum (ca. 900 bis 1400 n. Chr.) und anschließend eine Kleine Eiszeit Platz. Blickt man noch weiter zurück, werden die Ausschläge immer heftiger. Vor 120 000 Jahren lebten Flusspferde in Themse und Rhein, um schließlich kilometerhohen Eismassen zu weichen, die in fast ganz Europa für arktische Verhältnisse sorgten.
Klima und Natur sind immer in Veränderung begriffen, längere Phasen relativer Stabilität, wie wir sie seit etwa 10 000 Jahren erleben dürfen, eingeschlossen. Diese fast schon banale Feststellung lässt allerdings nicht ansatzweise erahnen, wie dramatisch sich diese Umbrüche auf die jeweils betroffenen Lebewesen auswirkten. Seit jeher war der Klimawandel ein Motor der Evolution (und der Geschichte). Und je nach Ausmaß der Veränderungen geriet die Biosphäre dabei in mehr oder weniger große Turbulenzen. Das wird diesmal nicht anders sein.
Wir neigen manchmal dazu, uns die Erdgeschichte als spannenden Abenteuerroman zu erzählen, als eine Art Langzeitsportveranstaltung oder Gladiatorenkampf, mit Verlierern, die es nicht gepackt haben, und Siegern, zu denen zweifellos bislang der Homo sapiens gehört, und wir vergessen dabei, wie viel Leid damit verbunden war, wie viel Blut vergossen wurde, wie verzweifelt und aussichtslos für viele der Kampf ums Überleben war, den der Wandel ihnen aufzwang. Tausende und Abertausende von Pflanzen- und Tierarten blieben dabei auf der Strecke. Ansätze zu vergleichbar dramatischen Vorgängen sind auch jetzt schon zu erleben, vor allem in den arktischen Lebensräumen. Und dabei wird es nicht bleiben.
Machen wir uns nichts vor: Was uns erwartet, ist in der Geschichte der Menschheit ohne Parallele. Diesmal sind wir mittendrin im Geschehen. Denn sogar ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um »nur« zwei Grad Celsius bis zum Ende dieses Jahrhunderts – ein Ziel, das für uns nur noch unter größten Anstrengungen zu erreichen sein wird – bedeutet: Im Jahr 2100 werden auf der Erde Bedingungen herrschen wie vor etwa zwei Millionen Jahren. Zu Lebzeiten des Homo sapiens sapiens und seiner unmittelbaren Vorläufer hat es das noch nie gegeben. Und der Weg wird weitergehen, weit über das Jahr 2100 hinaus. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist die Temperatur (bis zum Jahr 2019) bereits um 1,1 Grad gestiegen. So warm war es zuletzt am Ende des Eem-Interglazials (auch als »Riß/Würm-Interglazial« bekannt) vor 115 000 Jahren. Damals waren Neandertaler die einzigen Menschen in Europa.
Der moderne Homo sapiens verließ seine afrikanische Heimat nach heutigem Kenntnisstand vor etwa 60 000 Jahren. Dass sich unsere Spezies, wie schon der Homo erectus viele Hunderttausend Jahre vor ihm, überhaupt auf den Weg machte, ja dass unsere Vorfahren als aufrecht gehende Zweibeiner vor Jahrmillionen aus kletternden Affenahnen hervorgingen und ein großes Gehirn entwickelten, auch das war vermutlich eine Folge klimatischer Veränderungen. »Wie alle Arten sind auch wir ein Produkt unserer Umwelt«, schreibt der Astrobiologe und Wissenschaftskommunikator Lewis Dartnell in seinem Buch Urspünge. Wir seien »eine Primatenart, die ihre Entstehung dem Klimawandel und der Tektonik Ostafrikas« verdanke.
Unsere Spezies entstammt einem extrem vielgestaltigen und abwechslungsreichen Lebensraum, der noch dazu in der Zeit vor 2,7 bis 0,9 Millionen Jahren mehrfach von Phasen klimatischer Instabilität mit einem raschen Wechsel von Feucht- und Trockenzeiten heimgesucht wurde. Das hätte auch schiefgehen können. Doch es kam anders. »Intelligenz«, so Dartnell, »ist die evolutionäre Lösung für das Problem, dass sich ein Lebensraum schneller verändert, als die natürliche Selektion den Körper ummodellieren kann.«
Hat er recht? Das wären dann ja gar nicht die schlechtesten Aussichten … In jedem Fall bieten der Klimawandel und seine Folgen Gelegenheiten im Überfluss, diese unsere Intelligenz unter Beweis zu stellen. Nur schnell muss es gehen. Allzu viel Zeit bleibt uns nicht mehr.
© DuMont Buchverlag