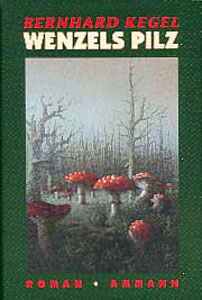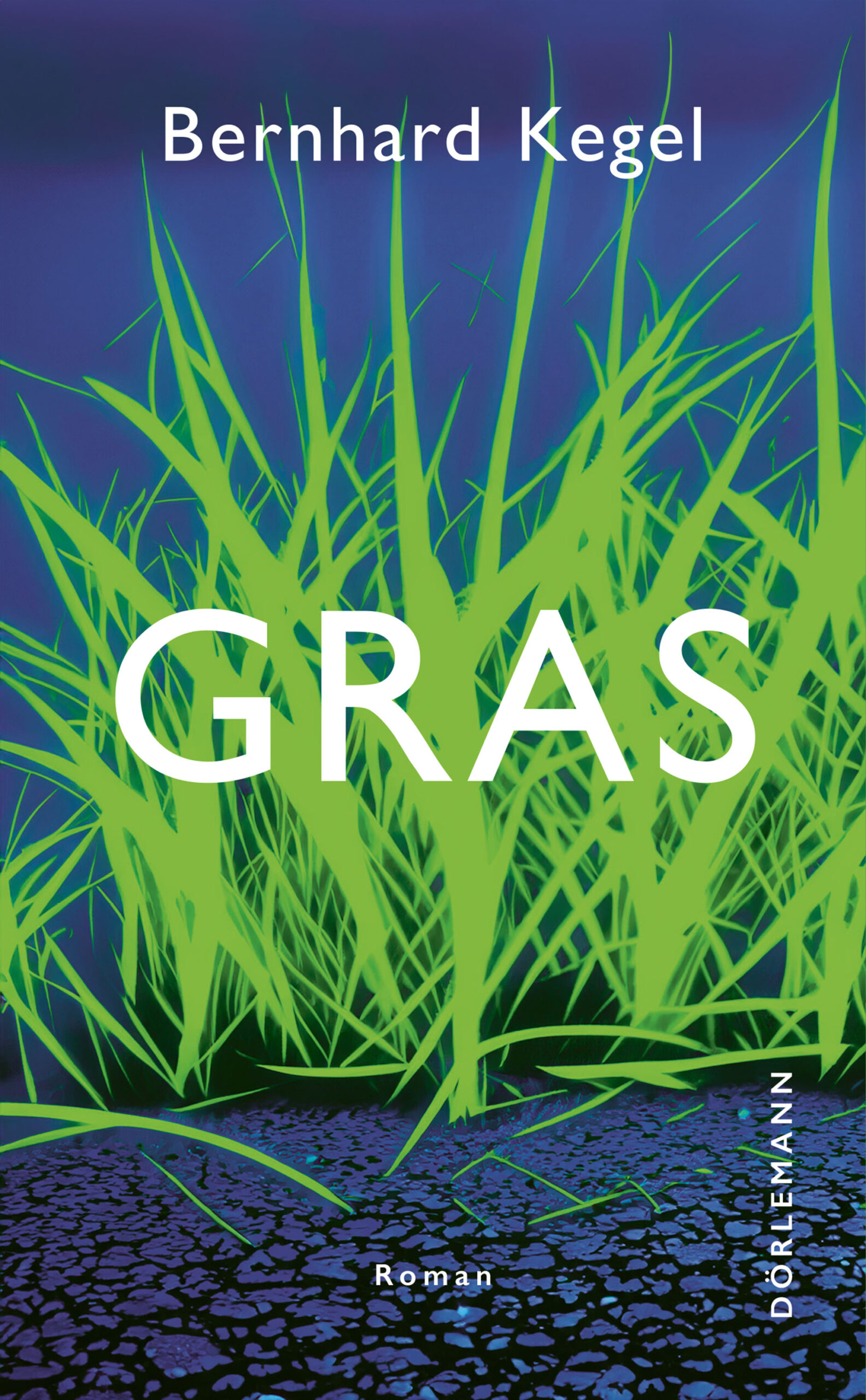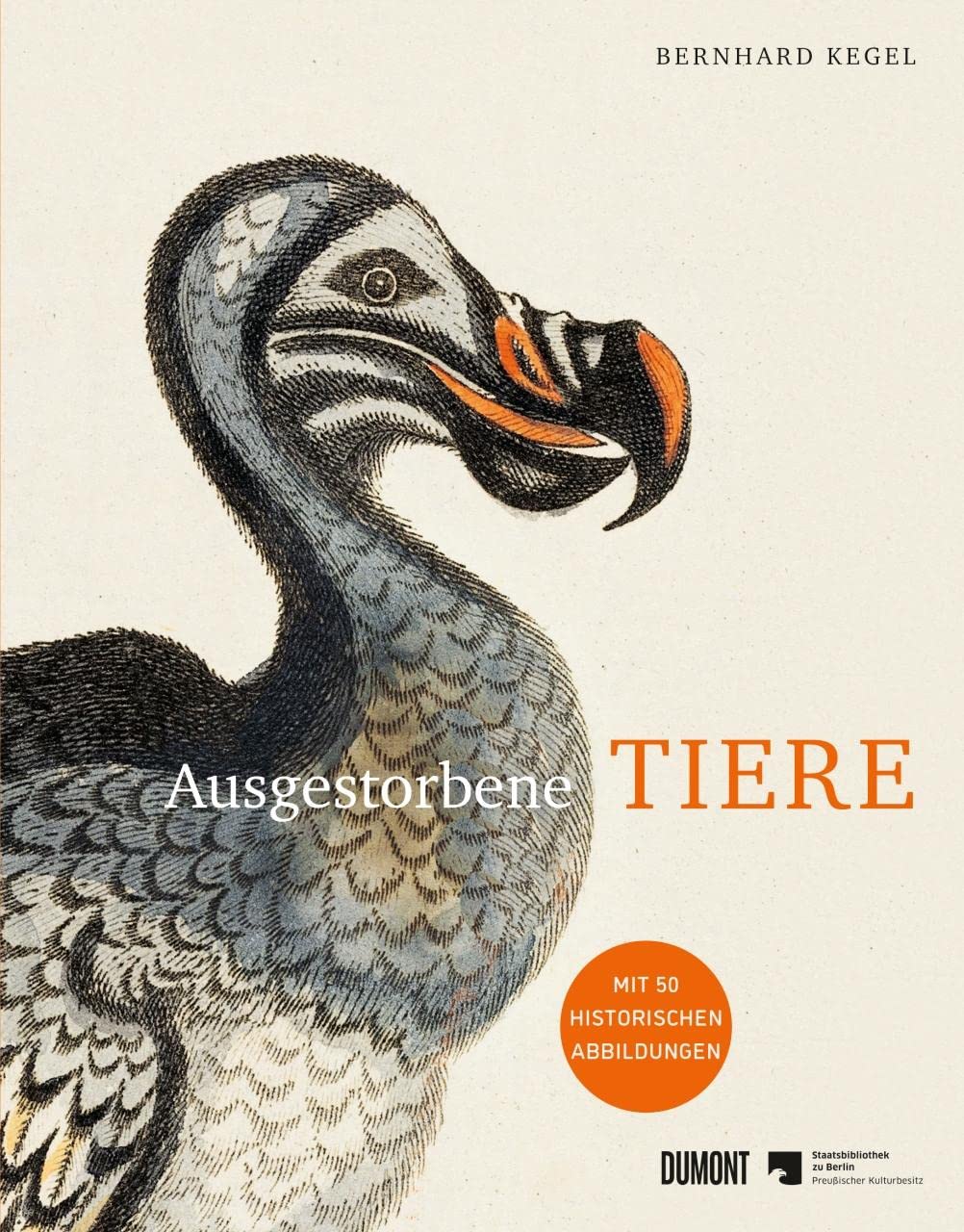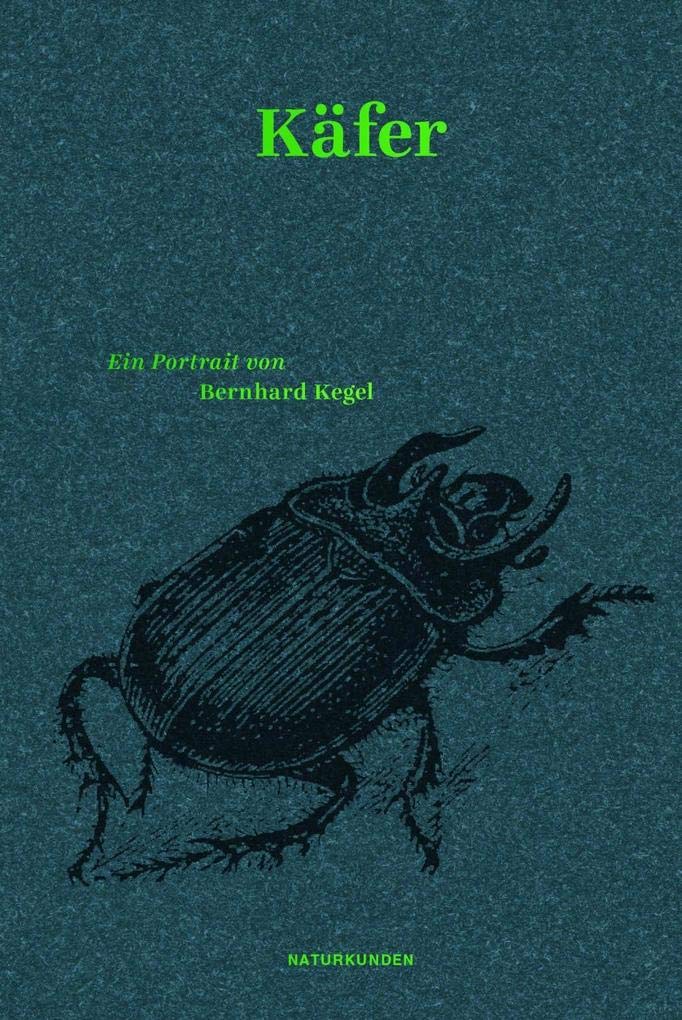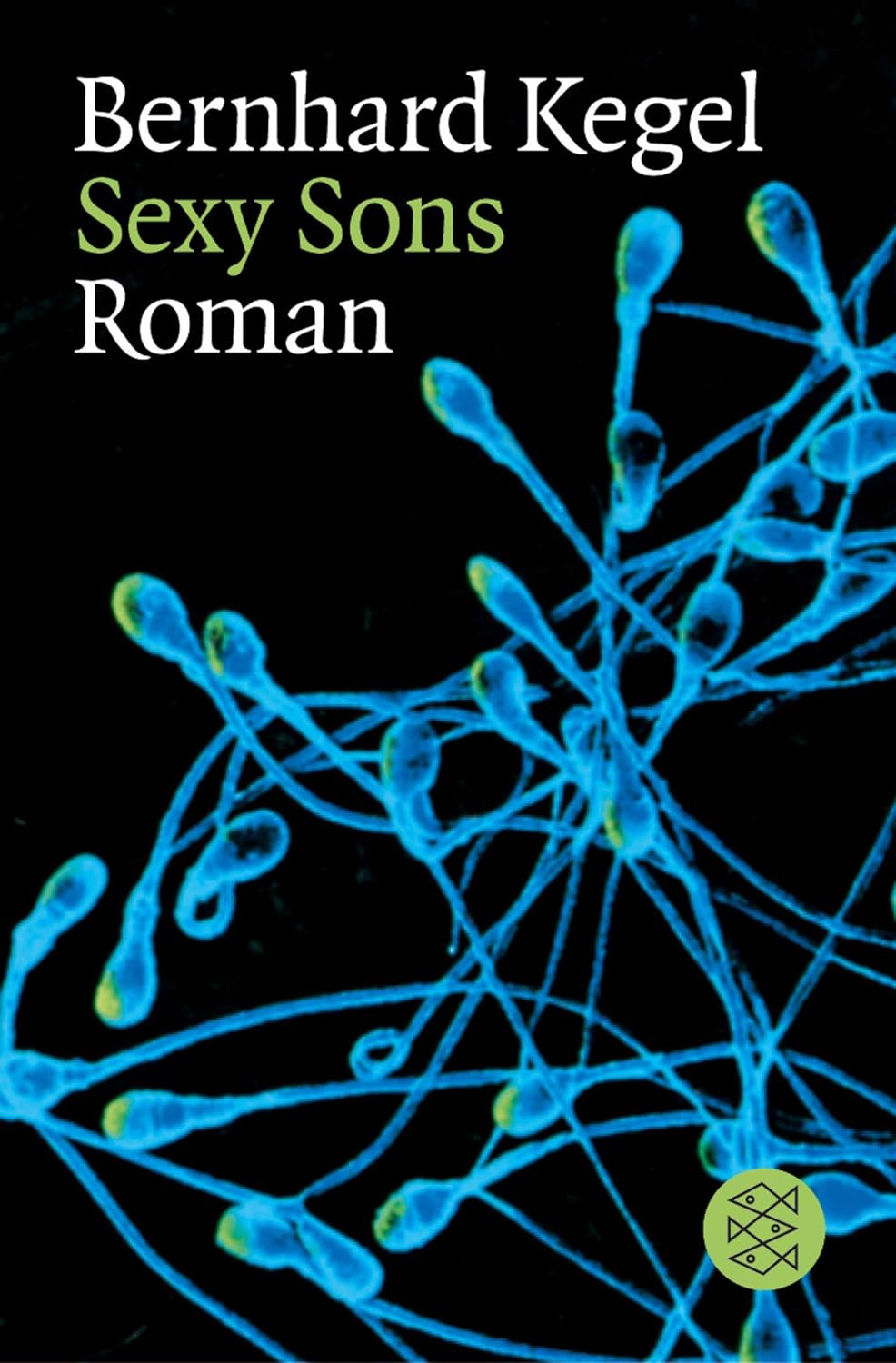1
Als das Telefon klingelte, träumte Kurt Wenzel gerade seinen Lieblingstraum. Er hatte mit einer schwungvollen Bewegung die Kennkarte aus der Brusttasche seines Laborkittels gezogen und war dabei, sie langsam in den Schlitz der Türsicherung zu stecken.
Wenzel schreckte augenblicklich hoch. Dieses Geräusch versetzte ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit in Alarmstimmung. Das leuchtende Ziffernblatt seines Weckers zeigte ein Uhr zwanzig.
Wer, um Himmels willen, konnte das sein?
In dem Moment, als er die Bettdecke zurückschlagen wollte, verstummte das Telefon. Seufzend ließ er sich in das Kopfkissen zurückfallen und trauerte seinem Traum nach.
Er liebte es, die Kennkarte in den Schlitz zu stecken, genoss die Geräusche, die das Gerät von sich gab, während es die Identität überprüfte, und er freute sich jedesmal, wenn die grüne Lampe aufleuchtete und die Tür mit einem Schnaufen in die Wand zurückwich.
Manchmal, wenn er überarbeitet war, hatte er Alpträume, in denen sich die Tür hartnäckig sträubte, den Weg freizugeben, und diese Befehlsverweigerung mit einem unerträglichen Geheul unterstützte. Die Lampe blinkte mit wahnwitziger Geschwindigkeit, versprühte stroboskopartige Lichtblitze. Meistens wachte er dann schweißgebadet auf und konnte nur mit Hilfe eines Beruhigungsmittels wieder einschlafen.
Hinter dieser Tür, die ihm soviel bedeutete, weil er einer der wenigen war, der sie öffnen konnte und eintreten durfte, befand sich der Eingang zu seinem gentechnischen Labor in der GENTEL (GENetik & InTELligenz), einem der führenden Unternehmen der blühenden biotechnischen Industrie.
Er war wieder eingeschlafen, als das Telefon erneut klingelte, und diesmal war die Panik, die das unvermittelte Geräusch in Wenzel hervorrief, so groß, dass er beim Aufspringen den kalten Pfefferminztee umstieß und über die rings um sein Bett verstreuten Zeitschriften verteilte. Das nächste Läuten ließ ihn wieder zusammenzucken, und während er mit der rechten auf dem Nachttisch nach seiner Brille suchte, versuchte er mit dem Kopfkissen in der linken Hand die wertvollen Fachzeitschriften abzutupfen. Endlich fand er seine Brille, ließ das Kissen auf den Boden fallen und tastete nach dem Schalter der Nachttischlampe. Mit dem nächsten Klingeln hatte er das Telefon erreicht und preßte mit gehetzter, rauher Stimme »Ja, hier Wenzel?« hervor.
»Da sind Sie ja endlich! Wo, zum Teufel, haben Sie gesteckt?«
Die Stimme traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Es war Eckstein, ausgerechnet Eckstein! Vor Schreck brachte er kein Wort heraus.
»Wenzel? Sind Sie noch dran? Hat’s Ihnen die Sprache verschlagen, Mann? Sie müssen sofort ins Labor kommen! Wir haben ein Problem!« sagte Eckstein mit barscher Stimme.
»Ins Labor? Jetzt? Ja, aber… es ist… es ist mitten in der Nacht. Ich muss morgen früh raus, ich meine, ich…«
»Ach! Glauben Sie vielleicht, ich wüsste nichts Besseres, als mir hier die Nacht um die Ohren zu schlagen?« brüllte Eckstein. »Machen Sie sich sofort auf den Weg! Ihr beschissener Pilz flippt aus!«
»Welcher Pilz, ich kenne keinen Pilz, ich meine… ich habe doch gar nichts mit Pilzen zu tun!« Wenzel war schockiert. Mit weit aufgerissenen Augen stierte er auf seine Promotionsurkunde, die neben dem Schreibtisch an der Wand hing.
»Wenn Sie nicht sofort kommen, sorge ich dafür, dass Sie nie wieder ein Reagenzglas in der Hand halten! Ich wusste ja, dass Sie unfähig sind, aber dass Sie uns so etwas einbrocken würden, hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Wenn Sie in dreißig Minuten nicht hier sind, erleben Sie Ihr blaues Wunder.«
Wenzel war einiges gewöhnt, was Ecksteins Umgangston anging, aber nun sackte er hilflos in sich zusammen.
»Ja, natürlich, ich…, ich komme sofort«, stammelte er. »Ich… ich verstehe nur nicht. Welcher Pilz? Was meinen Sie denn um Himmels willen?«
»Ihren Amanita natürlich, Sie Trottel! Können Sie sich an Ihre eigene Arbeit nicht mehr erinnern? In dreißig Minuten also!«
Ein lautes Krachen folgte. Wenzel ließ langsam den Hörer sinken.
Eckstein!
Wenn Wenzel überhaupt irgendeinen Menschen hasste, dann den Direktor der GENTEL-Forschungsabteilung. Dr. Eckstein, fast zwanzig Jahre jünger als er, war vom Leiter eines kleinen Entwicklungsteams zum Chef aller Forschungsgruppen innerhalb der GENTEL aufgestiegen, nur weil ihm zum rechten Zeitpunkt die Übertragung eines Häutungsgens der Mehlmotte auf das Schaf gelungen war. Dessen Zellen produzierten daraufhin Ecdyson, das Häutungshormon der Insekten, sinnloserweise.
Stammesgeschichtlich betrachtet waren Schaf und Schmetterling sehr weit voneinander entfernt, und solche scheinbaren Grenzen zu überschreiten galt eine Zeitlang als schick in Kreisen junger, aufstrebender Gentechnologen. Die Hormonrezeptoren von Säugetieren konnten rein gar nichts mit Ecdyson anfangen. Im Blut der Schafe schwamm jetzt neben Dutzenden von eigenen Botenstoffen auch ein Insektenhormon herum, was im Schafsorganismus weder nachweisbare Schäden anrichtete noch den ahnungslosen Tieren zu sensationellen neuen Fertigkeiten verhalf. Es war nur da, das war alles. Genau darin bestand der Erfolg. Das Gen kümmerte sich nicht um die ungewohnte Umgebung, in die man es versetzt hatte, sondern tat das, was es immer tat: Es produzierte Ecdyson.
Die Fachwelt hatte kopfgestanden: der erste gelungene Versuch, ein Insektengen in Säugetierzellen zu überführen. Was heute jedes zweitklassige Labor zustande brachte, war damals eine mittlere Sensation. Es gab einen riesigen Presserummel, und bei den unverbesserlichen Pessimisten brach der übliche Entrüstungssturm los.
Das alles war nur viel Lärm um nichts. Die Übertragung menschlicher Gene in Bakterienzellen hatte schließlich ganz am Anfang der Gentechnologie gestanden, und Escherichia coli und Homo sapiens waren nun wirklich die unterschiedlichsten Wesen, die man sich vorstellen konnte. Dass der genetische Code, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, universell war, wusste man seit den Kindertagen der Molekularbiologie. Eines erneuten Beweises hätte es kaum bedurft.
Eine große australische Boulevardzeitung musste die Sache damals falsch verstanden haben, denn sie berichtete in großer Aufmachung über die sensationelle Entwicklung einer neuen Schafrasse, die regelmäßig von selbst ihre Wolle abwarf. Es entstand erhebliche Unruhe unter den Schafzüchtern in Neuseeland und Australien. Die Menschen waren sehr verunsichert angesichts der sich überschlagenden Entwicklungen in der Biotechnologie. Innerhalb weniger Jahre gab es plötzlich frostresistente Kartoffeln, Mais, der sich seinen Stickstoffdünger aus der Luft holte, Orangensaft, zu dessen Herstellung keine Orangen mehr benötigt wurden, und bald sollte es sogar Steaks geben, die in einer Nährmaschine im eigenen Kühlschrank heranwuchsen statt an den Schenkeln und Rückenpartien lebender Rinder. Warum sollte es also keine Schafe geben, die sich von selbst häuteten?
Als das Missverständnis schließlich aufgeklärt wurde, entwickelte sich die Angelegenheit zu einem riesigen PR-Gag für die GENTEL, über den sich die halbe Welt erleichtert totlachte. Wieder einmal hatte sich gezeigt, dass die Vorurteile gegenüber der Gentechnik lediglich auf irrationalen Ängsten beruhten und nichts mit der Realität zu tun hatten. Diese Welle nutzte Eckstein wie ein erfahrener Surfer, um sich an die damals vakante Spitze der GENTEL-Forschungsabteilung spülen zu lassen.
Heute krähte natürlich kein Hahn mehr danach. Aber seitdem waltete dieser Schnösel in der Entwicklungsabteilung, wie er wollte. Wenzels zurückhaltendes, ängstliches Auftreten provozierte Eckstein. Immerhin war es ihm bisher nicht gelungen, Wenzel aus der GENTEL herauszugraulen. Dazu hatte er für das Unternehmen zuviel geleistet.
»Amanita…«, murmelte er vor sich hin.
Es war darum gegangen, einen Pilz zu züchten, der im versauerten Waldboden wachsen konnte. Die Sache war ewig her, alles war problemlos verlaufen, wie immer. Der Pilz war sicherlich einige Zeit getestet worden, um dann irgendwo freigesetzt zu werden oder, im ungünstigsten Fall, als digitalisierte Genkarte in einem Computerspeicher zu enden.
Er konnte sich nicht erinnern, jemals etwas über das weitere Schicksal seines Amanita gehört zu haben. Die weitere Verwertung seiner Entwicklungen interessierte ihn nicht besonders. Diese von übervorsichtigen Gesetzen geforderten Tests und Untersuchungen, diese mühseligen praktischen Probleme, die eine Arbeit unter den chaotischen Bedingungen der Natur unweigerlich mit sich brachte, waren sehr zeitaufwendig und wurden Gott sei Dank von einer anderen Abteilung der GENTEL durchgeführt.
Langweilige Routine, eine Schande, Verschwendung geistiger Ressourcen. Wenzel war ein Konstrukteur, ein Künstler, ein Ingenieur des Lebendigen. Diese kleinlichen Absicherungen, dieses ewige Geprüfe hielten nur auf. Er übergab seine Ergebnisse an die nächste Abteilung des GENTEL-Imperiums, klappte die Akte zu, und die Sache war für ihn erledigt. Meistens hatte er schon eine neue Idee im Kopf, mit der er sich beschäftigte und die er endlich in Angriff nehmen wollte.
Amanita war zudem eine dieser Auftragskreationen gewesen. Seine Begeisterung hielt sich damals sehr in Grenzen, und jetzt, gut zehn Jahre später, empfand er sogar Bitterkeit, wenn er daran dachte, dass ausgerechnet dieser Pilz von der Nomenklaturkommission der World Gene Data Base dazu ausgewählt wurde, seinen Namen zu tragen: Amanita Wenzeli.
Er hasste solche Zwangsschöpfungen, aber Gentechniker wie er verkamen allzu oft zu Notärzten auf einer ökologischen Unfallstation. Irgend jemand hatte schlampig gearbeitet, und er musste dann Umweltdoktor spielen.
Ihm lag es mehr, dem freien Spiel seiner kreativen Kräfte zu folgen. Unter Druck war er ein solider Wissenschaftler, wenn er aber frei von Vorgaben und Terminen arbeitete, wenn er seiner Imagination freien Lauf ließ, war er genial. Die Nördliche Stadtpalme, sein momentanes Projekt, würde das wieder unter Beweis stellen.
Leise vor sich hin fluchend ging er ins Bad, wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser und schaute voller Selbstmitleid in sein Spiegelbild.
»Amanita Wenzeli« , murmelte er vor sich. »So was! Alte Kamellen.« Er schaltete das Licht im Bad aus und ging zum Telefon, um sich ein Taxi zu rufen.
…
© Bernhard Kegel