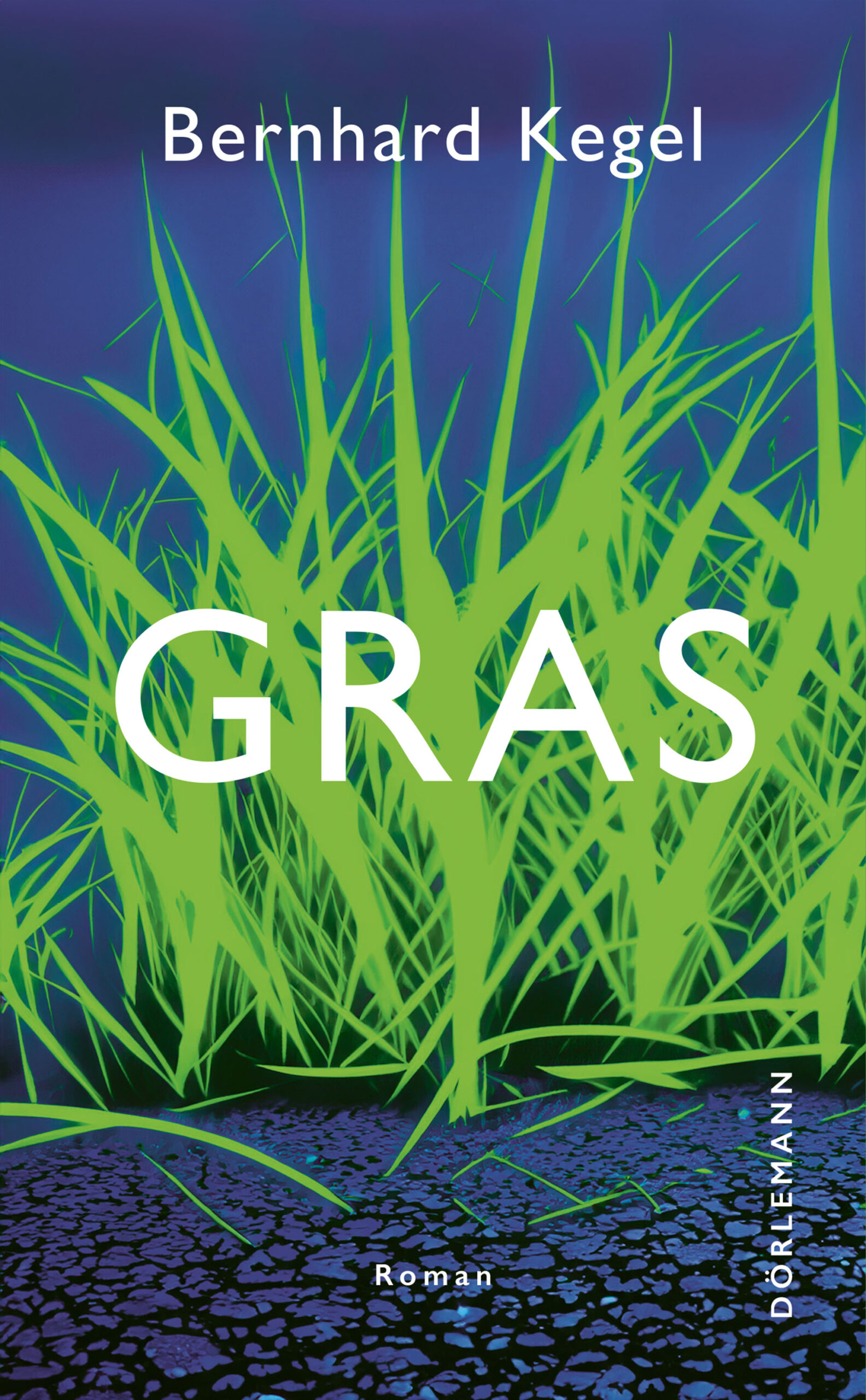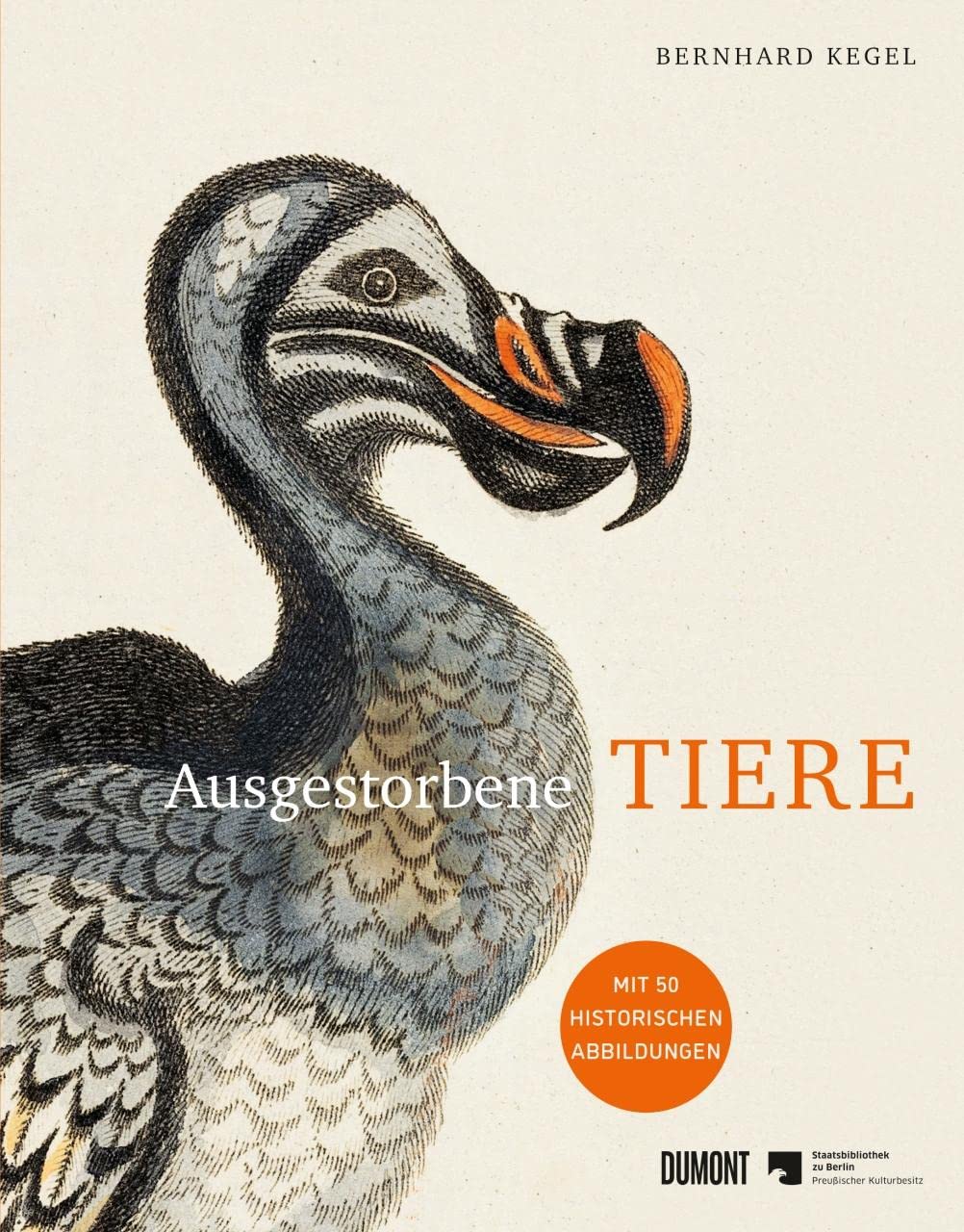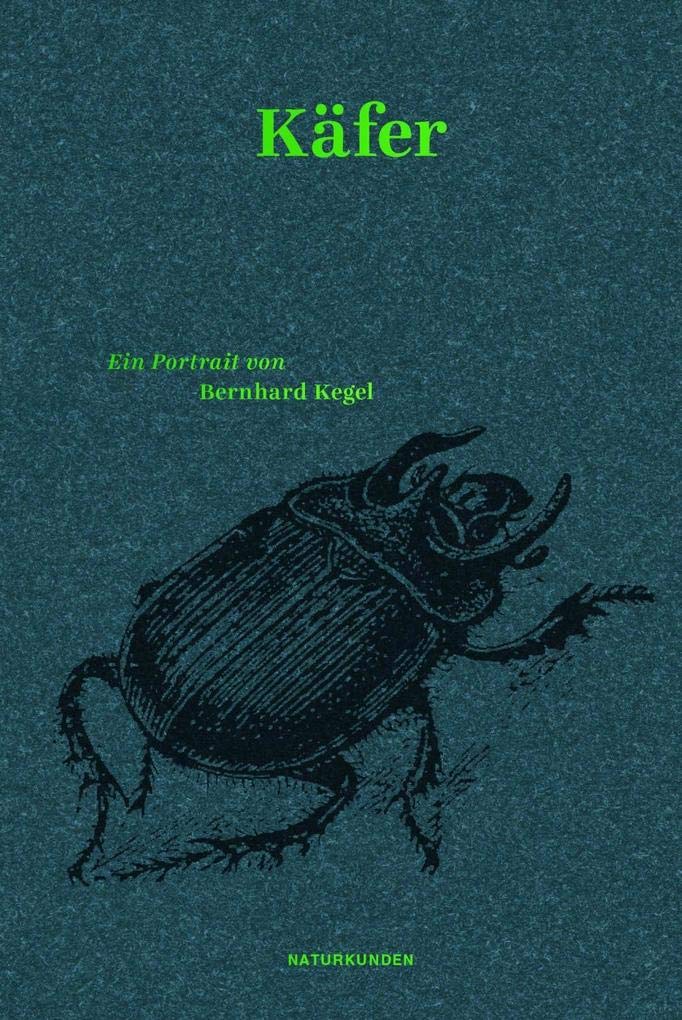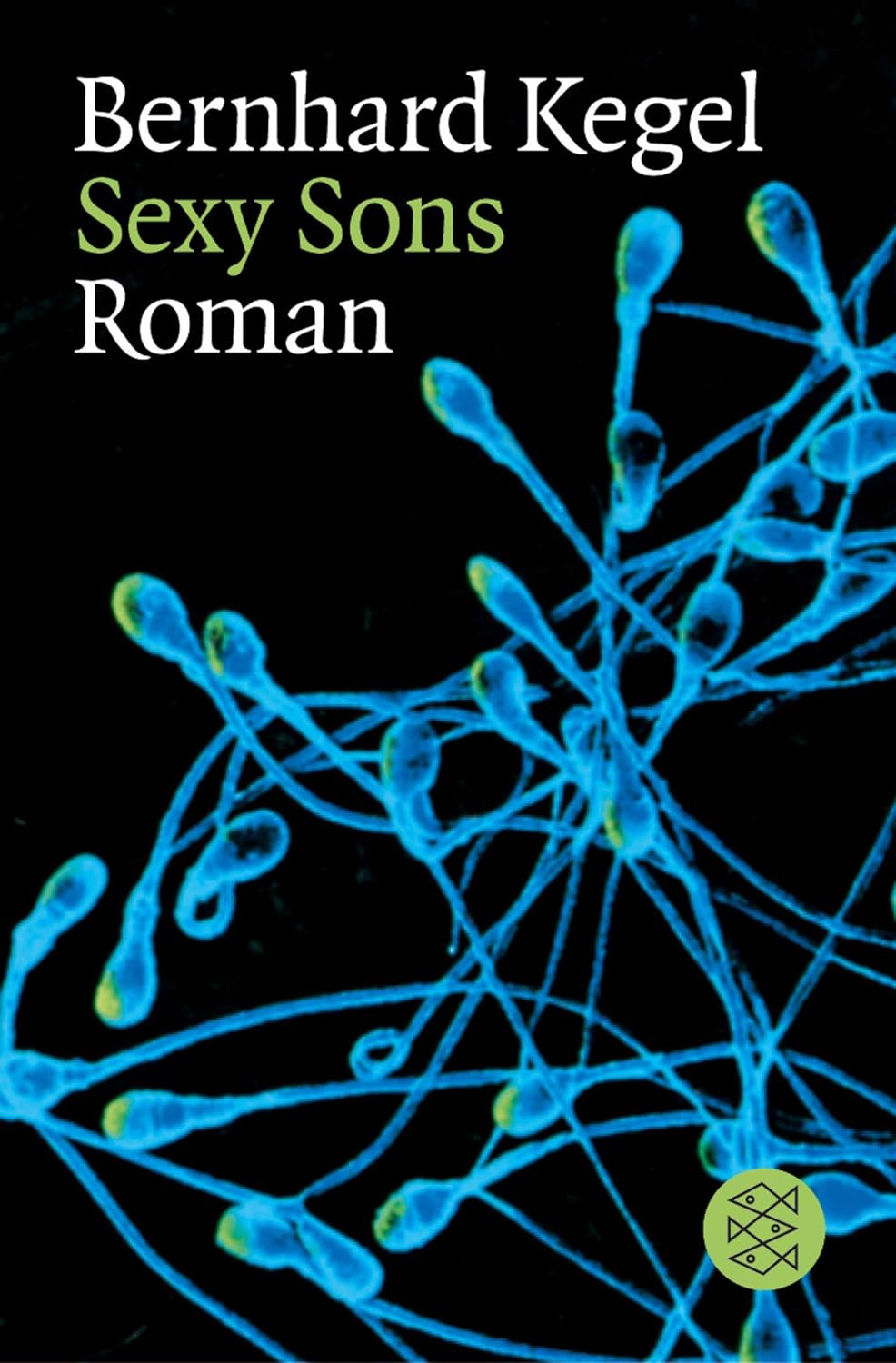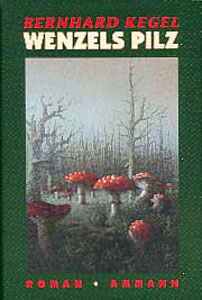Die Menschen aus Overkalix
Weit oben im Norden Europas, am Ende des langen Bottnischen Meerbusens, liegt die schwedische Provinz Norrbotten. Vermutlich könnte unsere Auftaktgeschichte überall in der Welt spielen, aber hier, zwischen Lappland und Finnland, nur wenige Kilometer südlich des Polarkreises, inmitten von Wäldern, Feuchtgebieten und Seen ist man ihr durch glückliche Umstände auf die Spur gekommen.
Für mitteleuropäische Verhältnisse ist Norrbotten ein nahezu menschenleeres Gebiet, in dem nur sieben Einwohner pro Quadratkilometer leben. In der kleinen Gemeinde Överkalix sind es noch weniger. Forstwirtschaft und ein wachsender Fremdenverkehr bieten den Menschen Arbeitsplätze, aber der Wohlstand von heute, die hübschen buntbemalten Holzhäuser und ‑kirchen und sogar ein prächtiges Hotel, das Grand Arctic, das in malerischer Lage am Zusammenfluss von Kalix und Ängesån steht, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Leben in Överkalix über lange Zeit hart und entbehrungsreich gewesen sein muss. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 1,3 °C, von Ende Oktober bis April herrscht Frost, im Januar und Februar erreicht das Thermometer durchschnittlich minus 11,5 °C, von den wenigen Stunden Tageslicht gar nicht zu reden. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch war Överkalix eine weit abgelegene, isolierte und verarmte Gemeinde, die häufig mit Missernten zu kämpfen hatte.
Die Geschichte, die aus Överkalix zu erzählen ist, hat mit Nahrung zu tun, genauer gesagt, mit einem zu viel oder zu wenig an Nahrung. Was wir essen, ist Privatsache und kommt nur uns selbst zu Gute. Denken wir zumindest. Wer sich ausreichend und gesund ernährt oder ernähren kann, profitiert davon. Wer Hunger leiden muss oder sich überfrisst, wer zuviel Fett oder Süßes zu sich nimmt, wer säuft und raucht, hat die gesundheitlichen Folgen selbst zu tragen. Die einzige Ausnahme sind die schwangeren und stillenden Mütter. Sie sind nicht nur für sich, sondern auch für ihre Kinder verantwortlich.
Was aber wäre, wenn Ähnliches für alle Menschen gelten würde, ob Mann oder Frau, wenn der Glauben, Qualität und Quantität unserer Nahrung habe nur Konsequenzen für uns selbst, auf Sand gebaut wäre, wenn das, was wir zu uns nehmen, nicht nur Folgen für uns und unsere Kinder, sondern sogar für unsere Enkel hätte? Mit welchem Gefühl würden wir dann die Pommes in die Majonäse tunken?
Normalerweise hatten Menschen, die vor hundert oder hundertfünfzig Jahren im äußersten Norden Europas das Licht der Welt erblickten, kaum Chancen in die Historie einzugehen. Dem Jahrgang 1905 ist dies jedoch in gewisser Weise gelungen, denn die Hälfte der 199 Menschen, die in diesem Jahr in der Gemeinde Överkalix geboren wurden, gelangten posthum in eine Zufallsstichprobe der Sozialmediziner Lars Olov Bygren und Gunnar Kaati, die Erstaunliches zu Tage beförderte und weit über Norrbotten hinaus Aufmerksamkeit erregte. Zwei dieser Menschen lebten Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts noch, drei hatten sich schon mit Anfang Zwanzig in die weite Welt verabschiedet und blieben unauffindbar. Der Rest der Stichprobe, 94 Söhne und Töchter von Överkalix, hatten hier ihr ganzes Leben verbracht, waren hier gestorben und hinterließen im Bevölkerungsregister der an der Universität Umeå archivierten demografischen Datenbank einen Sterbeeintrag samt Todesursache.
Lars Olov Bygren und Gunnar Kaati interessierten sich ursprünglich für den Zusammenhang zwischen der Ernährung von Kindern und Jugendlichen und ihrem Risiko, später an Erkrankungen von Herz und Kreislauf zu sterben. Mit lebenden Menschen wäre eine solche Untersuchung nahezu unmöglich, zumal wenn man auch die nächste und übernächste Generation im Blick hat. Sie würde Jahrzehnte dauern und wäre zudem ethisch äußerst fragwürdig. Wenn Menschen hungern, sollte man ihnen zu essen geben, anstatt ihrem Leiden tatenlos zuzusehen und abzuwarten, wann und an welchen Krankheiten sie zu Grunde gehen.
Die seit zweihundert Jahren geführten Gemeinderegister ermöglichen es aber, diesen Zusammenhang an historischen Datensätzen zu untersuchen. Dabei kam Bygren und Kaati der Umstand zu Hilfe, dass in Schweden seit 1799 auf Anordnung des Königs auch über Ernteerfolg und Lebensmittelpreise genau Buch geführt wird. Da es im 19. Jahrhundert in der Gegend weder Eisenbahnen, noch Straßen gab und im Winter durch das Zufrieren der Ostsee auch der Seeweg versperrt war, mussten die Bewohner von Överkalix nahezu ausschließlich mit den vor Ort auf schlechten Böden und mit einfachen Methoden produzierten Nahrungsmitteln auskommen. Die jährlichen Ernteerträge waren also ein recht gutes Maß für den jeweiligen Ernährungszustand der dort lebenden Bevölkerung.
Die Frage war: Hat das, was Mama und Papa und Oma und Opa in jungen Jahren erfahren und erlitten haben, einen Einfluss auf Lebenserwartung und Todesursache ihrer Kinder und Enkel? Mit Hilfe von Sören Edvinsson, der für die demografische Datenbank der Universität Umeå arbeitete, gelang es Bygren und Kaati, die Geburts- und Todesdaten fast aller Eltern und Großeltern des 1905er-Geburtenjahrganges ausfindig zu machen. Nun musste deren Leben nur noch mit den jeweils vorhandenen Nahrungsmittelmengen in Beziehung gesetzt werden.
Ein Blick in die Erntestatistik lässt erahnen, was die Vorfahren durchmachen mussten. Natürlich gab es auch gute und sehr gute Jahre, 1822 zum Beispiel, 1825 und 1826, auch 1828, 1841 und 1844. Aber darauf folgten, wie 1821, 1829 und 1851, immer wieder Totalausfälle. In einem Jahr gab es nicht genug Saatgut. In einem anderen zogen während des Schwedisch-Russischen Krieges zwei Armeen durch das Land und beschlagnahmten alles Essbare. Besonders hart müssen die 30er-Jahre gewesen sein, denn von 1831 bis 1837 konnte in Överkalix praktisch keine Ernte eingebracht werden. Die Not war groß.
Die Forscher unterteilten die Kindheit der Eltern und Großeltern in mehrere Perioden (für Jungen 0–2, 3–8, 9–12, 13–16 Jahre, für Mädchen 0–2, 3–7, 8–10, 11–15 Jahre) und untersuchten, ob in diese Perioden mindestens ein Jahr mit besonders guter oder schlechter Ernte fiel. Dann setzen sie die Ergebnisse in Bezug zum Lebensalter, das deren Kinder bzw. Kindeskinder erreichten.
In fast allen Fällen führte die Rechnung zu keinem signifikanten Zusammenhang. Gleichgültig, ob die Eltern im Kindesalter viel oder wenig zu essen hatten, ein Einfluss auf die Lebenserwartung ihrer im Jahr 1905 geborenen Nachkommen war nicht nachweisbar. Die Nahrungsmittelversorgung während der Kindheit von Großmutter und Großvater mütterlicherseits hatte ebenfalls keine erkennbaren Konsequenzen für die Enkel. Auch die Oma väterlicherseits hatte keinen Einfluss. Natürlich nicht, ist man versucht zu sagen. War die Fragestellung nicht von vornherein an den Haaren herbeigezogen?
War sie nicht. Denn als die Wissenschaftler als letzte noch zu berücksichtigende Größe die Kindheitserfahrungen der Großväter väterlicherseits in ihre Rechnung miteinbezogen, schalteten plötzlich alle Lämpchen auf rot. Der Zusammenhang, der sich hier und nur hier auftat, war nicht nur statistisch hoch signifikant, er war genau entgegengesetzt zu dem, was man intuitiv erwarten würde, und noch dazu von einer erstaunlichen Dimension. Nicht das Hungern des Großvaters, sondern im Gegenteil, ein von ihm vermutlich mit Freude und ohne jeden Reuegedanken konsumierter Nahrungsüberfluss verkürzte das Leben seiner Enkel um viele kostbare Jahre. Dagegen erhöhte sich deren Lebenserwartung in etwa demselben Maß, wenn Großvater Not leiden musste. Für die Generation der Enkel ging es dabei nicht nur um ein paar Wochen oder Monate. Zwischen den Extremen lagen 32 Jahre, nicht weniger als ein halbes Menschenleben.
Nun kamen die Kindheitsperioden ins Spiel. Denn der erstaunliche Zusammenhang, auf den die schwedischen Forscher gestoßen waren, galt nicht für die gesamte Kindheit der Großväter, sondern nur, wenn Nahrungsmangel oder ‑überfluss im Alter von 9 bis 12 Jahren herrschte, der sogenannten slow growth period, einer Art Stagnationsphase im Leben heranwachsender Jugendlicher, bevor sie als präpubertierende Teenager in die Höhe schießen. Davor und danach blieben Hunger oder Völlerei der jungen Großväter ohne Konsequenzen für die Lebenserwartung kommender Generationen. Das gleiche galt übrigens, wenn die Ernten während der slow growth period des Opas nur durchschnittlich ausgefallen waren. Offenbar machten die Extreme den Unterschied, das Zuviel oder Zuwenig an Nahrung. Wenn man sich seinen Großvater doch nur aussuchen könnte …
Die Ende der 1990er Jahre gewonnenen Ergebnisse waren statistisch abgesichert, trotzdem blieb vieles an dieser Studie unbefriedigend, vor allem die, wie die Autoren selbst einräumten, „bedauerlich geringe“ Zahl an Versuchspersonen. Deren eigene Lebensführung blieb völlig unberücksichtigt. Die getestete Sterblichkeit ist zudem ein sehr unspezifischer Parameter, der von zahllosen Einflussfaktoren bestimmt wird. Detailliertere Aussagen ließ die geringe Stichprobengröße aber nicht zu. Die 94 Männer und Frauen des Jahrganges 1905 aus Överkalix waren einfach zu wenig.
Nur ein Jahr nach ihrer ersten Untersuchung publizierten die schwedischen Forscher jedoch eine zweite Studie. Schon der Titel, in dem es um konkrete Todesursachen ging, machte deutlich, dass Bygren, Kaati und Edvinsson ihrem Ziel näher gekommen waren. Die Datengrundlage hatte sich entscheidend verbessert.
Diesmal waren drei Geburtenjahrgänge aus Överkalix in die Rechnung eingeflossen, die jeweils 15 Jahre auseinander lagen. Zu dem Jahrgang 1905 kamen die etwa gleichstarken Jahrgänge 1890 und 1920. Nachdem man wieder alle Personen aus den Stichproben gestrichen hatte, die noch lebten, deren Todesursache unbekannt war, die das Land mit unbekanntem Ziel verlassen hatten oder bei denen die Geburts- und Sterbedaten von Eltern und Großeltern nicht ausfindig gemacht werden konnten, blieben 239 Probanden übrig. Da zu jeder Versuchsperson sechs Vorfahren gehörten (die Eltern der Probanden und die Großeltern väterlicher- und mütterlicherseits), flossen die Daten von 1.434 Vorfahren mit ein.
Die verblüffende Bedeutung der Großväter väterlicherseits bestätigte sich auch diesmal, allerdings nur für den Jahrgang 1890, nicht für die, die dreißig Jahre später im Jahr 1920 geboren wurden. Vermutlich wirkt sich bei diesem späten Geburtstermin bereits aus, dass Missernten gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr die katastrophalen Auswirkungen früherer Zeiten erreichten. Das Krisenmanagement der Gemeinden war effektiver geworden und langsam verbesserte sich auch die Infrastruktur.
Für 123 der Versuchspersonen gaben die Gemeinderegister zumindest als eine der Todesursachen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems an. Bei 19 spielte Diabetes eine Rolle. Gab es einen Zusammenhang zwischen diesen Todesursachen und der Ernährung der Eltern und Großeltern?
Getestet wurde nur die offenbar besonders sensible slow growth period der Vorfahren. Wieder lieferten die Großväter die signifikantesten Resultate. Boten ihnen gute Ernten in Kindertagen die Gelegenheit zu üppiger Schlemmerei, hatten ihre Enkel ein um das Vierfache vergrößertes Risiko, an Diabetes zu sterben. Bei den Herz-Kreislauferkrankungen waren es die Väter, die ihren Kindern eine ernährungsbedingte Mitgift mit auf den Lebensweg gaben. Hatten sie schlechte Zeiten durchgemacht, waren ihre Kinder vor diesen lebensbedrohlichen Krankheiten relativ sicher.
Die schwedischen Forscher befragten ihren Datensatz noch unter einem weiteren Aspekt. Die Familien in Överkalix hatten erstaunlich viele Kinder, im Durchschnitt waren es sieben. In einem Viertel der Familien lebten mehr als zehn. Stand auch die Zahl der Enkel in einem Zusammenhang mit der Kindheit der Großväter? Wieder ergab sich ein signifikantes Ergebnis. Hatte der väterliche Großpapa reichlich zu essen, fiel die Kinderschar seiner Söhne deutlich kleiner aus (-0,66), musste er hungern, vergrößerte sich die Zahl seiner Enkel.
Was ging hier vor? Wie war die herausragende Bedeutung des Großvaters väterlicherseits zu erklären? Sein Pendant auf mütterlicher Seite konnte essen oder hungern, so viel er wollte, für die Enkelkinder war das ohne Bedeutung. Wie war es möglich, dass Erfahrungen des einen Großvaters auf irgendeine Weise gespeichert wurden, um dann die Generation seiner Kinder zu überspringen und sich erst bei seinen Enkeln auszuwirken, während beim anderen Großvater nichts dergleichen zu beobachten war? Was hier auch geschah, es schien in besonderem Maße die väterliche Abstammungslinie zu betreffen. Die Weitergabe musste über die Spermien erfolgen.
Die zweite Studie von Kaati, Bygren und Edvinsson war im angesehenen European Journal of Human Genetics erschienen, eine Zeitschrift, die offenbar auch von Wissenschaftsredakteuren gelesen wird. Der Spiegel brachte ein kurzes Interview mit Gunnar Kaati, auch die Zeit widmete sich dem Thema. Aber der Ton war ungläubig, fast spöttisch. „Feist, Opa!“ titelte die Zeit5 und witzelte: „Es ist nicht auszudenken, wie sich unser Verhältnis zu den Ahnen verändern wird, sollte der Schwede (Gunnar Kaati) Recht behalten. Jeden in jungen Jahren verputzten Hamburger würden wir dem Opa posthum verübeln. Und lebte der Alte noch, könnte das einen wahren Generationenkrieg auslösen.“ „Das klingt alles sehr gewagt“, kommentierte der Spiegel. Es ging ja nur um Statistiken. Und denen glaubt man bekanntlich nur, wenn man sie selbst gefälscht hat.
Marcus Pembrey vom University College London kannte das. Der Genetiker beschäftigte sich seit längerem mit solchen generationsübergreifenden Effekten, die der Genetik Hohn zu sprechen schienen. „Sie können die Resultate einfach nicht glauben“, sagte er und meinte die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die derartigen Untersuchungen grundsätzlich skeptisch bis ablehnend gegenüber stünden. Kann nicht sein, was nicht sein darf?
Immer wieder fiel ein Name: Jean-Baptiste de Lamarck. Und wie schon unzählige Male zuvor, wurde das umfangreiche Lebenswerk des französischen Zoologen wieder auf das berühmt-berüchtigte Giraffen-Beispiel verkürzt. In Lamarcks dreibändiger „Philosophie zoologique“ (1809) nimmt es zwar nur einen kurzen Absatz ein, trotzdem sind diese wenigen Zeilen und der Name ihres Verfassers zu einem Symbol für Wissenschaft geworden, die sich in falsche, ja abwegige Vorstellungen verrennt. Nach Lamarck, berichteten Spiegel und Zeit fast gleich lautend, habe nicht die fünfzig Jahre später von Darwin inthronierte natürliche Auslese zum langen Hals der afrikanischen Savannenbewohner geführt, sondern deren lebenslanger, fast Mitleid erregender Versuch, sich zu dem verführerisch unberührten Laub der Baumkronen zu strecken, was den Kopf jeder Giraffengeneration eine Winzigkeit in die Höhe beförderte.
In den Ohren von uns Heutigen, die wir mit Darwins Lehre aufgewachsen sind, kann diese Theorie nur lächerlich klingen, ein schon lange überwundener Irrweg. Wer zweihundert Jahre nach Lamarck noch immer eine Vererbung von Eigenschaften für möglich hält, die zu Lebzeiten erworben wurden, und aus dieser Richtung am Thron des großen Engländers zu rütteln wagt, der bekommt den geballten Zorn des wissenschaftlichen Establishments zu spüren. Nach gängiger Lehrmeinung konnte Großvaters in guten Överkalix-Kinderzeiten angefutterte Fettschicht unmöglich für den frühen Diabetes-Tod seiner Enkel verantwortlich sein. Ein Individuum, ob Mensch oder Tier, mag im Laufe seines Lebens viele bemerkenswerte Fähigkeiten erwerben, es mag gute und katastrophal schlechte Zeiten durchleben, der Weg zu den Genen in Spermien und Eizellen und damit zu kommenden Generationen bleibt diesen Einflüssen in jedem Fall versperrt. Basta.
„An Lamarck haben wir überhaupt nicht gedacht“, beteuerte Gunnar Kaati im Spiegel-Interview. „Aber in der Tat müssen wir wohl davon ausgehen, dass bei der Vererbung noch viele unentdeckte Faktoren eine Rolle spielen. Ich frage mich zum Beispiel, was es für zukünftige Generationen bedeutet, wenn zurzeit eine ganze Generation übergewichtiger Kinder heranwächst.“
Marcus Pembrey meldete sich zu Wort und ergriff im European Journal of Human Genetics Partei. Es sei endlich an der Zeit, Ergebnisse, wie sie die schwedischen Forscher erarbeitet hätten, ernst zu nehmen. Die Daten aus Överkalix seien ein Glücksfall für die Wissenschaft. Die Schweden hätten kein statistisches Trugbild, sondern ein reales Phänomen entdeckt: einen „nahrungsinduzierten, durch die Spermien weitergegebenen transgenerationalen Effekt.“ Pembrey legte dar, dass im kindlichen Hoden schon im Alter von acht Jahren die ersten Primären Spermatocyten auftauchten, Vorläuferzellen der Spermien, deren Zahl in den Folgejahren auf dem Weg in die Pubertät stark zunehme. Die slow growth period, die sich in den schwedischen Untersuchungen als besonders wichtig herausgestellt habe, falle daher mit einer sensiblen Frühphase der Spermienbildung zusammen, mithin „genau der Art von dynamischem Zustand, in dem ein nahrungsmittel-empfindlicher Mechanismus operieren könnte. (…) Wir brauchen eine unabhängige Bestätigung, aber diese Beobachtungen sollten zukünftigen Fragen völlig neue Richtungen geben.“
Vier Jahre vergingen ohne neue Nachrichten aus Överkalix, dann meldeten sich Bygren, Kaati und Edvinsson zurück, diesmal in Kooperation mit Marcus Pembrey und einem Autorenteam aus Großbritannien. Die Engländer brachten den riesigen Datensatz ihrer Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) ein, einer bis heute andauernden Langzeituntersuchung an über 14.000 Kindern, die 1991 und 1992 in der Nähe von Bristol geboren wurden, an deren Müttern und einem Großteil der Väter.
War es möglich, ähnliche transgenerationale Zusammenhänge, wie sie in Schweden gefunden wurden, auch an lebenden Menschen zu entdecken? Würde es gelingen, Einflussfaktoren dingfest machen, die während der slow growth period der Eltern einwirkten und zu Effekten bei den Kindern führten?
Da die Nahrungsmittelversorgung in einer Industrienation wie Großbritannien heute keine jährlichen Schwankungen mehr aufweist, waren Pembrey und seine schwedischen Kollegen gezwungen, sich nach anderen Einflüssen umzusehen. Die Lösung steckte in fast 10.000 Fragebögen, die den Vätern der englischen ALSPAC-Babys vorgelegt worden waren. Unter anderem wurde darin gefragt, ob die Probanden jemals geraucht hätten. Mehr als die Hälfte der Väter beantworteten die Frage positiv und fast alle konnten sich auch erinnern, wann sie zu regelmäßigen Rauchern geworden waren. Das am häufigsten genannte Alter war 16, aber 166 Väter berichteten, schon mit elf Jahren oder noch früher regelmäßig zur Zigarette gegriffen zu haben. Zu Beginn ihrer Raucherkarriere befanden sie sich damit noch in ihrer slow growth period.
Als die Forscher das Rauchverhalten der Väter mit dem sogenannten Body-Mass-Index der in regelmäßigen Abständen untersuchten Kinder in Beziehung setzten, erhielten sie genau das, wonach sie gesucht hatten. Denn im Alter von neun Jahren waren nur die Söhne der schon als Kinder rauchenden Väter deutlich übergewichtig. Bei den Töchtern war dieser Effekt nicht zu erkennen und auch die Jungen, deren Väter erst später und damit nach dem Ende ihrer slow growth period mit dem Rauchen begannen, zeigten keine Auffälligkeiten.
Das war ein wohltuender Rückenwind für die Forscher aus Umeå. Wieder war man auf einen geschlechtsspezifischen Effekt gestoßen, der sich erst in einer nachfolgenden Generation zeigte und mit der slow growth period der Väter zu tun hatte, diesmal allerdings in einer Population lebender Menschen und ohne Zuhilfenahme von historischen Daten, die nur indirekt über die während der Kindheit wirksamen Einflüsse Auskunft gaben. Das Netz an Indizien zog sich langsam zusammen, denn es gab auch überaus interessante Neuigkeiten aus Överkalix.
Die statistischen Auswertungsmethoden waren erheblich verfeinert worden, und nun richtete sich das Augenmerk vor allem auf die geschlechtsspezifischen Effekte. Wenn sich das frühe Rauchen der englischen Väter nur auf die Jungen auswirkte, wie verhielt es sich dann mit den schlemmenden oder hungernden Großvätern aus Överkalix?
Bisher hatten die schwedischen Forscher bei den drei Geburtsjahrgängen nicht nach Frauen und Männern unterschieden. Doch gerade durch diese Unterscheidung nach Geschlecht erhielten die Ergebnisse eine verblüffende, bisher verborgen gebliebene Dimension. Denn nun zeigte sich, dass nicht nur die Nahrungsmittelversorgung der Großväter väterlicherseits von erheblichem Einfluss auf die Lebenserwartung ihrer Enkel war, sondern auch die ihrer Frauen. Dieser Einfluss war in beiden Fällen gleich gerichtet, Nahrungsüberfluss zu Kinderzeiten der Großeltern war für die Enkel von Nachteil und umgekehrt. Er beschränkte sich allerdings in erstaunlich strikter Weise ausschließlich auf das eigene Geschlecht. Ob gut oder schlecht, die Versorgungslage der Großväter hatte nur für ihre männlichen Enkel Konsequenzen, und für deren Schwestern war ausschließlich das relevant, was die Großmütter väterlicherseits erlebt und erlitten hatten. Die mütterliche Seite war ohne jede Bedeutung. Die neuen Ergebnisse aus Schweden gewannen zusätzlich an Aussagekraft, als sie in übereinstimmender Weise an zwei unabhängigen Stichproben gewonnen wurden, den Jahrgängen 1890 und 1905.
Da sich schon früh die Bedeutung der slow growth period herausstellte, hatten sich alle folgenden Arbeiten der Schweden auf diese Kindheitsphase von Eltern und Großeltern konzentriert. Jetzt lieferten die Forscher eine viel genauere Analyse, die die Nahrungsmittelversorgung der Großeltern von ihrer Zeit als Fötus bis zum Alter von zwanzig Jahren zum Inhalt hatte. Zu Beginn ihrer Arbeit hatten Bygren und Kaati die Dauer der slow growth period auf Grund von Literaturdaten festgelegt, die an heute lebenden Kindern gewonnen wurden, und sie hatten sie um ein Jahr vorverlegt, um die Verschiebung der Pubertät zu berücksichtigen, die in den letzten hundert Jahren stattgefunden hat. Jetzt stellte sich heraus, wie sehr sie damit ins Schwarze getroffen hatten. Hätten sie Beginn und Ende dieser Periode nur um ein oder zwei Jahre anders gesetzt, die in den Daten verborgene Information wäre womöglich bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden. Genau in den von den Forschern gesetzten Grenzen der großelterlichen slow growth period zeigten sich nämlich bei den Enkeln die stärksten Effekte.
Nur die ersten drei Lebensjahre der Großmütter erwiesen sich als noch einflussreicher, die Zeit also, die sie als Fötus im Bauch der Urgroßmütter, als Stillbaby in deren Armen und als Brei futterndes Kleinkind auf deren Schoß verbrachten. Für ihre Enkellinnen, und nur für diese, erwies es sich als besonders verhängnisvoll, wenn die Ernteerträge in diesen entscheidenden Jahren gegen Null gingen. Während dieser Zeit wirkte sich eine gute Ernährungslage der Großmutter also sehr positiv für die Enkelinnen aus. Warum sich dieser Zusammenhang dann während der slow growth period umkehrt, bleibt vorerst ein Rätsel.
2007 erschien die bislang letzte Överkalix-Arbeit der schwedischen Forscher, in der sie eine Schwachstelle ihrer Untersuchung ausräumten. Auch wenn sie die individuellen sozialen Lebensumstände ihrer Versuchspersonen aus den Jahrgängen 1890 und 1905 berücksichtigten, änderte sich an den Resultaten nichts. Egal, ob die Probanden früh ihre Eltern verloren, ob sie die Erst- oder Letztgeborenen waren, wie viele Geschwister sie hatten, ob der Vater Landbesitzer oder Analphabet war, der Zusammenhang zwischen der Ernährungslage der Großeltern väterlicherseits und dem Sterberisiko der Enkel blieb bestehen.
Warum hat eine gute Versorgungslage während der offenbar entscheidenden slow growth period der Großeltern für die Enkel so negative Folgen? Und abgesehen von Zigarettenrauch und Nahrungsmenge, welche Einflüsse wirken noch über die Grenzen der Generationen hinaus? Spielt vielleicht nicht nur eine Rolle wie viel, sondern auch was wir essen? Wenn Hunger und Völlerei derartige Wirkung entfalten können, was ist mit eindrücklichen und traumatischen Erlebnissen anderer Art, mit schweren Krankheiten, mit Krieg, Vertreibung oder Missbrauch?
Für Lars Olov Bygren, Gunnar Kaati und Marcus Pembrey bestehen kaum noch Zweifel: Sowohl die britischen ALSPAC‑, als auch die Överkalix-Resultate stützen die Hypothese, dass beim Menschen „ein genereller Mechanismus existiert, der Informationen über die Umwelt der Vorfahren über die männliche Abstammungslinie weitergibt.“ Die alte erbittert geführte Diskussion über das Verhältnis von Umwelteinflüssen und genetischer Veranlagung dürfte damit in eine neue Phase gehen. Die Sünden (und das Leid) der Väter, sie scheinen uns auf eine Weise zu verfolgen, die noch vor kurzem für unmöglich gehalten wurde.
Nach Meinung der Forscher ist eine Beteiligung der Geschlechtschromosomen die naheliegendste Erklärung. Die Weitergabe von Großvater über den Vater zum Sohn könnte über das Y‑Chromosom erfolgen. Und das von der Großmutter stammende X‑Chromosom des Vaters kann von diesem nur an seine Töchter weitergegeben werden, nicht an die Söhne, die ja stattdessen sein Y‑Chromosom und ein X‑Chromosom der Mutter erhalten, was genau dem beobachteten Zusammenhang entsprechen würde.
Nur … wie und in welcher Form gelangt die Information auf das Chromosom? Erleben wir, nicht nur auf Grund der schwedischen Untersuchungen über die Menschen aus Överkalix, tatsächlich die Wiedergeburt der Lamarck’schen Idee von der Vererbung erworbener Eigenschaften?
© 2009, DuMont Buchverlag, Köln